Die Kunst des Schenkens
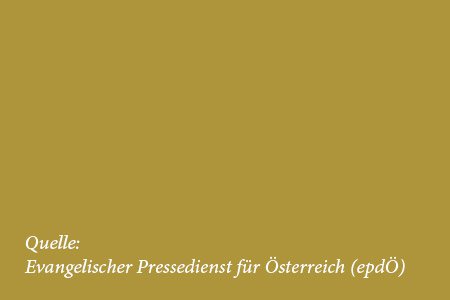
Julia Schnizlein über ein schwieriges Unterfangen
In zehn Tagen ist Weihnachten und nicht wenige geraten langsam in Panik. Viele hetzen durch Einkaufsstraßen oder scrollen durch Online-Shops, auf der Suche nach dem „richtigen“ Geschenk. Kaum etwas ist so alltäglich und oft auch so schwierig wie Schenken. Denn wer schenkt, erwartet meist etwas zurück – sei das Dank, Nähe, Anerkennung oder zumindest das gute Gefühl, einem anderen eine Freude gemacht zu haben. Ökonomen behaupten sogar, es gäbe keine uneigennützigen Geschenke.
Schon in der Bibel wird viel geschenkt – und selten ohne Hintergedanken. Jakob etwa, der nach Jahren der Flucht seinem Bruder Esau wiederbegegnet. Um dessen Zorn zu besänftigen, schickt er ihm ganze Herden von Schafen, Ziegen und Kamelen entgegen. Kein Geschenk aus Großmut, sondern aus Angst. Seine Gaben sollen versöhnen, nicht erfreuen. Oder König Saul, der dem jungen David vor dem Kampf gegen Goliath seine eigene Rüstung schenkt – viel zu groß, viel zu schwer, unpassend. Ein Geschenk, das mehr mit Kontrolle als mit Wertschätzung zu tun hat. Saul will, dass David kämpft, wie er es für richtig hält. Aber David legt die Rüstung ab – und besiegt den Riesen mit einer Steinschleuder.
Schenken kann fesseln, verpflichten, Erwartungen wecken. Manche Geschenke erzählen mehr vom Selbstbild der Schenkenden als von den Beschenkten: ein Parfum, das man nie tragen würde, ein Küchengerät, das man nicht braucht, ein monströses Bild für eine winzige Wohnung. Und doch steckt selbst hinter solchen Geschenk-Flops oft ein ehrlicher Wunsch: gesehen zu werden und in Beziehung zu treten.
Fragt man Menschen nach den schönsten Geschenken ihres Lebens, erzählen sie selten von teuren Dingen. Es sind die kleinen, liebevollen Gesten, die in Erinnerung bleiben: eine Thermoskanne Tee vor der Wohnungstür nach einer Nacht im Krankenhaus. Ein Fotoalbum voller Erinnerungen, die man selbst vergessen hätte. Die Kassette, auf der Oma früher Geschichten vorgelesen hat – jemand hat sie aufbewahrt und plötzlich wird wieder ein Stück Kindheit hörbar. Oft sind es geschenkte Zeit und gemeinsame Erlebnisse, die bleibende Eindrücke hinterlassen: ein gemeinsamer Konzertbesuch, ein Ausflug, eine kurze Reise. Oder einfach das reparierte Fahrrad, die geflickte Jacke, das neu angenähte Teddyohr – alles Zeichen von Zuwendung und Hingabe.
Schenken ist eine Kunst, aber Empfangen nicht minder. Viele von uns wiegeln ab: „Das wäre doch nicht nötig gewesen.“ „Ach nein, wirklich, ich brauche doch nichts …“. Vielleicht aus Bescheidenheit, oft aber aus Unsicherheit. Denn wer annimmt, macht sich verletzlich. Kinder können das noch: Sie nehmen ein Geschenk einfach an. Keine Gegenrechnung, kein schlechtes Gewissen. Sie staunen. Vielleicht ist das die eigentliche Meisterschaft des Empfangens.
Der Grund des Weihnachtsfestes liegt jedenfalls in einem Geschenk, das frei von Berechnung ist. Gott schenkt sich selbst. Er tritt als Kind in Beziehung zu uns – wehrlos, bedürftig, offen. Der Gott in der Krippe zeigt keine Großzügigkeit von oben herab, sondern eine Liebe, die unten beginnt: im Empfangen, im Angenommensein. Er verteilt nicht, sondern empfängt; er zeigt, dass Liebe keine Preisschilder braucht und führt uns am eigenen Leib vor, dass wir geliebt werden, bevor wir irgendetwas zurückgeben können.
Vielleicht ist das die große Einladung dieses Festes: die Hände einen Moment zu öffnen – im Geben wie im Nehmen – und zu spüren, wie wenig es braucht, damit zwischen zwei Menschen etwas Heiliges entsteht.
